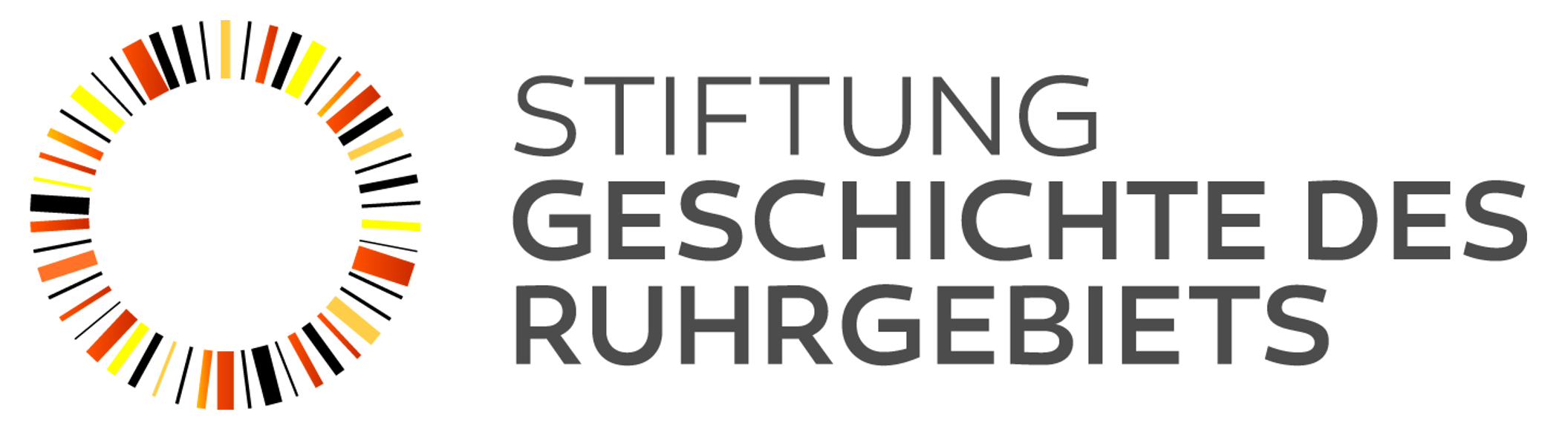Bochumer Historikerpreis
Preisträger 2023: Frank Trentmann

Im Rahmen des Stiftungsfestes der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets ist der in London und Helsinki lehrende Historiker Frank Trentmann am 15. November 2023 mit dem 8. Bochumer Historikerpreis ausgezeichnet worden.
Der Bochumer Historikerpreis wird seit 2002 im Dreijahresrhythmus vergeben und würdigt ein herausragendes Lebenswerk im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Er ist mit 30.000 € der derzeit am höchsten dotierte Preis für Historikerinnen und Historiker in Deutschland. Die Regularien des Preises sehen außerdem vor, dass er bevorzugt an Historikerinnen und Historiker vergeben wird, deren Arbeiten auch für die Geschichtsschreibung über das Ruhrgebiet richtungsweisend geworden sind. Vor Frank Trentmann haben Lutz Niethammer, Jürgen Kocka, Eric Hobsbawm, Christoph Kleßmann, Marcel van der Linden, Catherine Hall und Lutz Raphael den Preis erhalten.
In seiner Begrüßung bedankte sich der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets, Bernd Tönjes, insbesondere bei der Evonik Industries AG, die durch ihr großzügiges finanzielles Engagement die Preisverleihung erst ermöglicht und damit zugleich ihre enge historische Verbundenheit mit dem Ruhrgebiet dokumentiert. Für die Stifter des Preises – die Ruhr-Universität Bochum, die Stadt Bochum und die Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets – hatte Professor Stefan Berger bereits zuvor begründet: „Wir zeichnen ein Werk von höchster, international anerkannter Exzellenz aus und einen Historiker, der als Public Intellectual national wie international weit über das akademische Fachmilieu hinaus Gehör findet.“ Insbesondere seine Forschungen zur globalen Geschichte des Konsums besäßen eine hohe gesellschaftliche Aktualität, beispielsweise wenn Trentmann die Folgen des Konsums für die Klimapolitik untersucht. Seine Fragestellungen können damit auch in hohem Maße anregend und wegweisend für die künftige historische Ruhrgebietsforschung sein.
Frank Trentmann ist gebürtiger Hamburger und studierte in Hamburg, London und Harvard. Nach seiner Promotion in Harvard mit einer Untersuchung über die Erosion des britischen Freihandels in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts lehrte Trentmann als Assistant Professor an der Princeton University. Anschließend wechselte er an das Birkbeck College der University of London, wo er 2006 zum Professor of History berufen wurde. Seit 2018 bekleidet er zusätzlich eine Professur am Centre for Consumer Society Research der University of Helsinki und nahm zudem zahlreiche renommierte Gastprofessuren wahr. In seinem Hauptwerk „Empire of Things“ („Herrschaft der Dinge“) durchleuchtet Trentmann 600 Jahre globale Kulturgeschichte. In seinem erst wenige Wochen vor der Preisverleihung in Deutschland erschienenem, in britischen und deutschen Feuilletons euphorisch besprochenen Buch „Aufbruch des Gewissens. Eine Geschichte der Deutschen von 1942 bis heute“ erzählt Trentmann aus einer moralgeschichtlichen Perspektive, wie aus dem deutschen Tätervolk der 1940er Jahre der heute international anerkannte und respektierte Partner Deutschland wurde.
Die Laudatorin Reinhild Kreis, Professorin für die Geschichte der Gegenwart an der Universität Siegen, würdigte Trentmann als einen „Grenzüberschreiter“ in mancherlei Hinsicht. Mit ihrem globalgeschichtlichen Zugang überschreiten seine Forschungen geografische Grenzen. Zugleich überschreiten sie die disziplinären Grenzen der Geschichtswissenschaft, Trentmann schreibt und arbeitet interdisziplinär. In seinen Forschungen zur Konsumgeschichte richtet er so den Blick auf Politik, Ökonomie, Kultur, Gesellschaft, Alltag und Moral – das alles gehöre für Trentmann zusammen. Seine Bücher, so Kreis, zeichnen sich durch eine hohe Anschaulichkeit aus, sind interessant und kurzweilig geschrieben und werden deshalb auch außerhalb des Kreises der Geschichtswissenschaftlerinnen und Geschichtswissenschaftler gerne gelesen. Leserinnen und Leser lernen durch ihre Lektüre nicht nur viel über Geschichte, sondern werden auch angeregt, über sich selbst nachzudenken. Dabei hinterfrage Trentmann vermeintliche Gewissheiten unerbittlich, beziehe Position und sei stets bereit, sich in aktuelle Debatten einzuschalten. Hierbei vermeide er einseitige Argumentationskonstrukte und bereichere Debatten als „grenzenloser Denker“.
In seiner Festrede zum Thema „Mensch und Materie: Das Schreiben der Geschichte in Zeiten des Klimawandels“ stellte Trentmann drei Ausgangsfragen: Wie sind wir in die Situation der Klimakrise gekommen? Welche Pfade wurden eingeschlagen oder eben nicht betreten? Was können wir stattdessen unternehmen? Trentmann verortete entscheidende Weichenstellungen für die Durchsetzung einer Konsumkultur im 18. Jahrhundert, als die Erkenntnis um sich griff, dass der Mensch durch das Materielle geprägt ist, mit dem er sich umgibt (oder auch nicht umgibt). Einstige Luxusartikel – Trentmann illustrierte dies am Beispiel des Schirmes – wandeln sich zu allgemeinen Bedarfsartikeln, bedienen ein vermeintlich allgemeines Grundbedürfnis. Das Leitmotiv dieses Wandels von Materiellem zum „Normalen“ in Überflussgesellschaften explizierte Trentmann an vier Beispielen des „Haushaltskonsums“, die starke Auswirkungen auf Energieressourcen zeitigten: das Heizen, das Baden und Duschen, das Kochen sowie das Autofahren. Während früher nur die Wohnküchen beheizt worden seien, begünstige der Mythos der „sauberen Energie“ aus der Steckdose heute das Beheizen aller Räume. In der Konsequenz sei die durchschnittliche Raumtemperatur in Großbritannien zwischen 1970 und 2010 von 14 auf 18 Grad Celsius gestiegen. Im Wandel vom Flussbaden und von der Zinkwanne zum separaten Badezimmer in jeder Wohnung habe sich das tägliche Baden und Duschen normalisiert, neue Sauberkeits- und Schönheitsideale hätten zudem das tägliche Wechseln der Wäsche zur Norm erhoben. Dagegen sei die Entwicklung von der rauchenden, mit Holz befeuerten Kochstelle zum „Solar-Kochen“ mit Fehlschlägen verbunden gewesen. Mitunter werden an manchen Orten Dampfkochtöpfe noch immer über einer einfachen Feuerstelle genutzt. Die Wende zum „motorisierten Individualverkehr“ habe zu einer täglichen Nutzung des Autos von durchschnittlich 67 Minuten geführt und die individuelle Reisetätigkeit vervielfacht.
Ein „grünes Wachstum“, die Trennung von Wachstum und Energieverbrauch, verlange nach effizienteren Technologien und zugleich nach einem nachhaltigeren Lebensstil von jedem Einzelnen. Für HistorikerInnen stellt sich damit die Frage nach der Herkunft und Genese der materiellen Bedürfnisse. Es sind unsere (alltäglichen) Gewohnheiten als Einzelne, schlußfolgerte Trentmann, die die Klimakrise forcieren. Diese Gewohnheiten sind jedoch in unterschiedlichen Ländern und Kulturen verschieden und auch unterschiedlich verteilt.
Der Abend endete für die etwa 150 Gäste der Preisverleihung mit einem Empfang in den Räumlichkeiten der Stiftung.
Foto: Thea Struchtemeier / Pressse HGR